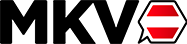Geschichte des MKV
Zu einem Spezifikum der österreichischen Bildungslandschaft zählt der Umstand, dass bereits an Gymnasien Professoren lehren. Dementsprechend wurden bereits die Schüler der Oberstufe mitunter als „Studenten“ bezeichnet. In krassem Widerspruch dazu stand das in der Monarchie geltende Verbot, an höheren Schulen Vereine zu bilden oder sich solchen anzuschließen. Wollten die k. u. k. Bürokraten damit für Ruhe in den Klassen sorgen, erreichten sie bei den 15-18jährigen, überwiegend männlichen Betroffenen das genaue Gegenteil. Der „Reiz des Verbotenen“ bewirkte eine breite studentische Subkultur mit geheimen Verbindungen.
Erst die 1876 entstandene Teutonia Innsbruck, heute die älteste Verbindung des MKV, konnte sich dauerhaft behaupten. Mit ein Ziel dieser studentischen Organisationen war es, an den von liberalen und oft auch nationalen Professoren beherrschten Mittelschulen katholisches Gedankengut zu vertreten.
Nach 1900 entstanden innerhalb weniger Jahre in beinahe allen heutigen Bundesländern katholische Mittelschulverbindungen, von denen sich die meisten dem bereits 1900 gegründeten „Mittelschüler-Cartell-Verband“ (MCV) anschlossen. Noch knapp vor dem 1. Weltkrieg löste sich dieser wieder auf.
Mit dem Zusammenbruch der Monarchie wurde den Mittelschülern die „Koalitionsfreiheit“ gewährt, erst ab diesem Zeitpunkt konnten sie an das Licht der Öffentlichkeit treten. Zur selben Zeit entstand als Nachfolger des MCV der „Verband katholisch – deutscher Pennalverbindungen Österreichs“ (VPV), dem im Laufe der Zeit 68 Verbindungen angehörten und der 1921 mit der „Burschenwacht“ eine Verbandszeitschrift herausbringen konnte. Gegen 1930 zerfiel er aber aufgrund interner Streitigkeiten.
Parallel dazu bildete sich der „Christlich-Deutsche Studentenbund“ (CDSB) als politische Interessensvertretung der Mittelschüler, dem auch Mädchen angehörten und der sich erfolgreich auf kulturellem, sozialem und schulpolitischem Gebiet (etwa gegen die zeitweise geplante Abschaffung des Religionsunterrichts in den Schulen) engagierte.
In den Bezeichnungen der Organisationen dieser Zeit und auch der Verbindungen kommt häufig der Ausdruck „deutsch“ vor, die heute seltsam anmutet und nur aus dem Zusammenhang der Zeit zu verstehen ist. Einen Österreich-Patriotismus im heutigen Sinne gab es damals über weite Strecken noch nicht, sodass die aus der Vielvölker-Monarchie übernommene, sprachlich definierte Selbstbezeichnung kritiklos übernommen wurde. Recht bald sollte sich das Dilemma dieser sprachlichen Unschärfe herausstellen, da sich viele Kartellbrüder oft genug unter Einsatz ihres Lebens für ein unabhängiges Österreich engagierten.
Zahlreiche Verbindungen engagierten sich mehr und mehr für pro-österreichische Aktivitäten, auch wenn darunter das eigentliche Verbindungsleben immer mehr zu kurz kam. Als die Einrichtung einer einheitlichen Jugendorganisation im Sinne des „Ständestaates“ verlangt wurde, lehnte der MKV aber einen Beitritt ab und schloss sich der, unter kirchlicher Führung stehenden, „Reichsarbeitsgemeinschaft katholischer Jugendverbände Österreichs“ an, die eine größere Bewegungsfreiheit garantierte.
Der rasche Aufstieg des MKV fand in der Nacht vom 11. auf den 12. März 1938 ein jähes Ende, als die Nazis die Buden (Verbindungsheime) stürmten und alles zerstörten oder beschlagnahmten. Die Verbindungen wurden von den neuen Machthabern aufgelöst und hunderte ihrer Mitglieder gemaßregelt, verhaftet oder in Konzentrationslager gebracht. Viele fanden den Tod in diesen Lagern oder wurden hingerichtet. Viele gingen in den Untergrund, gründeten Widerstandsgruppen oder beteiligten sich aktiv am Widerstand und dem Kampf für ein freies und unabhängiges Österreich.
Ab der zweiten Hälfte der 1960er Jahre begann der MKV sich systematisch in der Schulpolitik zu engagieren und kann heute auf große Erfolge verweisen. So gehen vor allem die großen Reformen der Schülervertretung und der Lehrplangestaltung in Österreich in vielen Dingen auf Impulse und Anregungen des MKV zurück. 1972 folgte die maßgeblich von Kartellbrüdern und dem MKV selbst mitgetragene Gründung der „Union Höherer Schüler“ (UHS; heute: „Schülerunion“), um auf noch breiterer Basis positiv wirken zu können. Bis heute bringen sich Kartellbrüder als Klassen- und Schulsprecher ein und wiederholt haben MKVer als Landes- und Bundesschulsprecher gewirkt.
Damit entstand eine Interessensplattform christlicher Studentinnen und Studenten aus ganz Europa , die sich als NGO stark bei Europarat und europäischem Parlament engagiert.
In den 1980er Jahren und erneut 2010 widmete sich der MKV einer ausgiebigen Grundsatzdiskussion. Am Ende dieses breiten Prozesses stand das aktuelle Grundsatzprogramm. In den letzten Jahren konnte der MKV wieder einen starken Aufschwung verzeichnen. Die verantwortlichen Kartellbrüder haben das Bildungs- und Seminarangebot ausgebaut, Initiativen im schulpolitischen Bereich gesetzt und sich in der jugend- und bildungspolitischen Diskussion wieder verstärkt zu Wort gemeldet. Dabei ist es gelungen, für die Verbindungen einen Mehrwert zu schaffen, das Profil des Verbandes in der Öffentlichkeit zu schärfen und aktives christliches Engagement in unserer Zeit zu leisten.