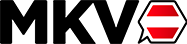Extra - Couleur
Die digitale Erweiterung der Printausgabe.
- Juni 2025
- April 2025
- Januar 2025
- Dezember 2024
- November 2024
- Oktober 2024
- September 2024
- Juli 2024
- Juni 2024
- April 2024
- Februar 2024
- Dezember 2023
- November 2023
- Oktober 2023
- September 2023
- August 2023
- Juli 2023
- Mai 2023
- Januar 2023
- Dezember 2022
- November 2022
- Oktober 2022
- Juli 2022
- Juni 2022
- Mai 2022
- April 2022
- März 2022
- Dezember 2021
- November 2021
- Oktober 2021
- September 2021
- August 2021
- Juli 2021
- Juni 2021
- Mai 2021
- März 2021
- Februar 2021
- Januar 2021
- Dezember 2020
- November 2020
- Oktober 2020
- September 2020
- August 2020
- Juli 2020
- Juni 2020
- Mai 2020
- April 2020
- März 2020
- Februar 2020
- Januar 2020
- November 2019
- September 2019
- August 2019
- Juli 2019
- Mai 2019
- April 2019
- Februar 2019
- Juli 2018
- Juni 2018
- Mai 2018
- April 2018
- März 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
Alle Gastbeiträge in voller Länge

Durch Schengen verbunden
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Dem Staat kommt hier die Aufgabe zu, Sicherheit zu schaffen. Dass diese Möglichkeiten des Staates durch Freiheits- und Grundrechte, durch Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat, (mehr …)
WeiterlesenMit dem Gutschein zum Erfolg
Mit einer einfachen, aber effizienten Idee hat die KÖStV Herulia zu Stockerau sich in ihrer Community neu positioniert und tolle PR für sich gemacht. Am Anfang stand die Idee, die ausgezeichneten schulischen Leistungen unserer (mehr …)
Weiterlesen
Sola scriptura oder: Was bringt das Gesetz?
Abseits von Sinn und Unsinn eines fein ziselierten Detailgrades der Gesetzgebung soll der Gedanke ins Rollen gebracht werden, wie das gesatzte Recht unsere Gesellschaft formt und welchen Einfluss es auf ihre Mitglieder hat.
WeiterlesenDas Beste, was mir in meinem Leben passiert ist!
Seit 1. Juli ist Wolf Steinhäusl v. Dionysos (FOE) als Nachfolger von Sebastian Skupa (AMV) Kartellsenior des MKV. Im Interview mit Tobias Klaghofer (VBW) spricht er über seine Pläne und Ambitionen. Du bist jetzt seit kurzem (mehr …)
WeiterlesenEuropa-Abgeordneter Lukas Mandl (KRW) im Gespräch
Ein ausführliches Interview über Grundwerte, Demokratie, Brexit und die Zukunft der EU.
WeiterlesenZur Beschränkung der Macht
Demokratie lebt aber von einem möglichen Wechsel der Herrschaft und muss unabhängig von der ideologischen Ausrichtung der Parteien bleiben. So wie jedes Machtinstrument unterliegt sie damit der ständigen Herausforderung der Beschränkung der Macht.
WeiterlesenDer arbeitsfreie Sonntag (Ausgabe2|17)
Über die Notwendigkeit einer Reform des Sonntagsöffnungsverbots wird seit langem diskutiert. Kirchen und Gewerkschaften, Wirtschaftskammer und einige ÖVP-Teilorganisationen haben sich in dieser gesellschaftspolitischen (mehr …)
WeiterlesenAusgabe 2|17
Interviews: Die vollständigen Transkripte
In der Printausgabe, aber auch in der pdf-Version gibt es eine Kurzform der Interviews. Hier findet Ihr die vollständigen Fragen und Antworten.
Der 6. April 2017 bedeutet einen Umbruch in Oberösterreichs Politik. Mit Thomas Stelzer das Industriebundesland einen neuen Landeshauptmann. Der neue Landeschef im Gespräch über Wirtschaft, Werte und Wandel.
Das Gespräch führte Philipp Jauernik (FRW)
3. März 1995. Was sagt Dir dieses Datum?
An diesem Tag wurde Josef Pühringer Landeshauptmann von Oberösterreich.
Was hast Du an diesem Tag gemacht?
Ich war im Landtag, weil ich gerade Mitarbeiter im Landtagsklub der OÖVP war. Für uns war das ein bewegender Moment – wir sind mit Ratzenböck groß geworden, es war ein sehr emotionaler Übergang.
Hast Du an diesem Tag schon geahnt, einst selbst Landeshauptmann zu werden?
Nein, absolut nicht. Ich war Landesobmann der JVP, mein Ziel damals war bei der Landtagswahl 1997 als Jugendvertreter in den Landtag einzuziehen.
Es heißt, man habe schon, als Du JVP-Obmann in Oberösterreich warst, über Dich gesagt, „der wird einmal Landeshauptmann“. Sind solche Erwartungen eine Bürde?
Erstens wird über politisch aktive Menschen immer viel geredet und viel interpretiert. Zweitens gibt es wirklich schlimmeres als wenn dir jemand nachsagt, dass du einmal etwas werden könntest. Das ist ein bisschen ein Luxusproblem.
Ich frage deshalb, weil es ja derzeit einen anderen aufstrebenden Jungstar gibt, über den es schon seit Jahren heißt, „der wird einmal Bundeskanzler“. Das Titelbild Deiner Facebookseite zeigt Dich mit ihm – Sebastian Kurz.
Jung genug dafür ist er, und begabt genug ist er auch.
Ist das eine Parallele?
Das weiß ich nicht, aber Sebastian und mich eint, dass wir bei den Grundwerten übereinstimmen. Außerdem wollen wir beide etwas bewegen.
Stichwort Werte. In einem Interview hast Du dazu einmal die Formulierung „konservativ wie Franz Josef Strauß“ verwendet. Was verstehst Du darunter?
Strauß hat viele bemerkenswerte Dinge gesagt und sehr viel bewegt. Sein Credo war, moderne Konservative gehen an der Spitze des Wandels. Das ist auch mein Zugang – wenn man von einem festen Wertegerüst aus Gesellschaft gestaltet, hat man keine Notwendigkeit, ständig ein Revoluzzer sein zu müssen, aber man hat die nötige Kraft, die richtigen Änderungen zur richtigen Zeit herbeizuführen.
Was sind diese notwendigen Änderungen heute?
1995 gab es große Veränderungen, etwa auch durch den EU-Beitritt und die Ostöffnung. Heute ist wieder so eine Umbruchszeit. Der technische Fortschritt, Stichwort Digitalisierung, verändert unser Leben, wie wir arbeiten, was wir arbeiten. Das Gefüge der Welt, auch in Europa, ist im Wandel. Da müssen wir unsere Position finden. Wir müssen uns viel stärker in eine selbstbewusste Europäische Union einbringen. Dazu kommen die Veränderungen für die Gesellschaft durch die aktuelle Völkerwanderung, den Zuzug. Die Herausforderungen sind ganz anders gestrickt als früher. Darauf müssen wir neue Antworten finden, weil die alten Politikmuster vielerorts nicht mehr passen.
Selbstbewusstere Europäische Union – was meinst Du damit? Der Boulevard unterstellt der EU nicht gerade, zu wenig Einfluss zu nehmen.
Mit selbstbewusst meine ich klare und effiziente Lösungen für die Dinge, für die die EU gegründet wurde. Dazu gehört eine gemeinsame Außen- uns Sicherheitspolitik. Siehe Fluchtbewegungen – wir ernten jetzt, dass diese Bereiche zu stark national geblieben sind, zu wenig koordiniert wurden.
Ein zweites Thema ist dabei wiederum der technische Fortschritt. Wir schauen in puncto Innovation nach Kalifornien, Europa ist eher Importeur. Mir schwebt eine Art europäischer Kraftakt vor, ähnlich wie es einst in der Flugzeugindustrie mit Airbus geschehen ist. Wir müssen ein Hort des technischen Fortschritts werden – gemeinsam. Bei kleineren politischen Fragen sollen wiederum die Nationalstaaten mehr selbst machen, die sind oft vor Ort näher dran.
Die Nationalstaaten – oder eher die Bundesländer?
Zu selbstbewussten Nationalstaaten gehören aktive Bundesländer.
Es heißt oft, man kann in der Außenpolitik nicht ernstgenommen werden, wenn man über keine ernstzunehmende Armee verfügt. Brauchen wir eine europäische Defensivarmee?
Wenn man das ernsthaft betreiben will, gehört das natürlich dazu. Wie man das genau gestaltet, da will ich als Regionalpolitiker jetzt nicht hineinreden. Aber grundsätzlich ist das natürlich klar.
Du sagst, der Konservative sollte an der Spitze des Fortschritts stehen. Fortschritt bedingt Reformen –in Österreich hört man da immer die Schlagworte Bundesstaatsreform, Verwaltungsreform. Mit EU, Bund, Ländern, Bezirken, Gemeinden gibt es ein recht dichtes Netz, das auch dazu führt, dass für viele Bürger nicht mehr sichtbar ist, wer für welche Entscheidung verantwortlich ist. Wie hoch siehst Du die Chancen auf solche Reformen?
In der Landes- und Kommunalpolitik haben wir einen sehr engen Bezug zum Bürger. Es wird auch erwartet, dass du ansprechbar bist. Das ist für mich unverzichtbar, auch weil wir für den Standort dadurch viel zielgenauer arbeiten können. Österreich ist allerdings wirklich ein Paradebeispiel für verschlungene Kompetenzen. Jeder ist für einen Teil zuständig – ich würde es bevorzugen, Kompetenzen klarer aufzuteilen. Vieles ist historisch gewachsen und hatte seine Berechtigung, aber wir leben in einer anderen Zeit.
Die jüngeren kennen die vielbesungene Aufteilung des Landes in Schwarz und Rot nur noch aus den Geschichtsbüchern.
Das alte Gefüge der beiden Großparteien hat sich umgekehrt. Was ist heute noch eine Großpartei? Hier in Oberösterreich gibt es uns als Nummer eins, dahinter die FPÖ und erst mit Abstand Rot und Grün. In anderen Ländern ist es umgekehrt, siehe Wien oder Kärnten. Auch das zeigt, dass wir ein Stück weit in einem neuen Zeitalter leben.
Wir sehen derzeit Wechsel. Stelzer neu in Linz, Mikl-Leitner neu in St. Pölten. Auch in Salzburg und Innsbruck sind die Landeschefs andere Typen als man sich früher den Landesvater vorstellte. Inwieweit spiegelt sich dieser Wechsel im Amtsverständnis wieder?
Aus meiner Sicht muss es eine Konstante geben: Der Kontakt zum Bürger, der mich erdet. Dazu gibt es aber so viele neue Herausforderungen, gerade an einen Industriestandort wie Oberösterreich. Die Zusammenarbeit mit Wirtschaft, Industrie und Arbeitnehmervertretung – das verlangt einen neuen Typus. Und es ist auch eine neue Generation am Ruder, das stimmt.
Welche Rolle kann in der heutigen Zeit ein Bundesland spielen? Die Welt ist globalisiert.
Wir sind ein Industriestandort und damit auch ein riesiger Arbeitsplatzstandort. Wenn wir das bleiben wollen, heißen unsere Konkurrenten nicht Wien oder St. Pölten, sondern wir matchen uns mit Regionen weltweit. Das ist eine Herausforderung. Internationale Betriebe können heute in Texas oder Südkorea genausogut investieren. Daran muss man sich orientieren, weil wir den Ehrgeiz haben, ein starker Standort zu bleiben. Dazu haben wir eine neue Energiestrategie beschlossen, als Beispiel – und wir müssen unsere oberösterreichischen Interessen im Kontext der Gesamtrepublik vertreten.
Du sprichst von der globalisierten, arbeitsteiligen Wirtschaft. In den USA ist Donald Trump mit protektionistischen Slogans angetreten und will, vereinfacht gesagt, Betriebe für das Auslagern der Produktion steuerlich benachteiligen. Ist der konservative Landeshauptmann von heute Freihandelsbefürworter, Raubtierkapitalist oder Protektionist im Trachtenjanker?
(lacht) Wir haben 650.000 Beschäftigte in Oberösterreich. Wenn ich das halten will, muss ich ein Produktionsstandort bleiben. Ohne Außenbezug geht das nicht, Oberösterreich hat über 60 Prozent Exportquote. Klar ist, dass diese Außenbeziehungen geregelt sein müssen. Natürlich kann man Freihandelsabkommen kritisieren – aber die Frage geht eher an die Politik: Sind diese Dinge zu spät kommuniziert worden? Hat man das Feld zu stark jenen überlassen, die – teilweise auch zurecht – Kritik üben? Das gilt auch in anderen Bereichen. Man darf nie glauben, etwas sei zu kompliziert, um es den Leuten zu erklären. In der heutigen Politik bringe ich nur noch dann etwas durch, wenn ich rechtzeitig kommuniziere. Die Politikverdrossenheit kommt auch stark daher, dass die Menschen das Gefühl haben, es werde ihnen etwas verheimlicht. Das darf nicht sein.
Bei CETA, das die Bundesregierung immer mitverhandelt hat, war die Industriellenvereinigung nahezu allein mit ihrer Kampagne. In London hat David Cameron erklärt, er sei gegen den Brexit, aber nachher kaum kampagnisiert. In den Niederlanden hat Premier Rutte eine Abstimmung für ein vom ihm verhandeltes Abkommen mit der Ukraine angesetzt und dann nur zaghaft dafür geworben. Ist das ein Versagen der politischen Führung?
Absolut. Ich gehöre nicht zu denen, die jammern, dass überall die Populisten gewinnen. Ich frage eher selbstkritisch, warum die so ein breites Feld haben. Wir sehen das auch in Österreich, wo wir die Themen Zuwanderung und Integration viel zu lange einer Seite überlassen haben. Darüber hat man nicht gesprochen. Man muss die Themen, die die Menschen bewegen, anpacken und Lösungen anbieten. Das machen wir jetzt auch, gerade mit dem Integrationspaket. Das ist kein einfacher Weg, aber er muss sein.
Gehen wir wieder zum Begriff „konservativ“ zurück. Seit Strauß haben sich lange nur wenige getraut, sich dazu bekennen – wird unsere Gesellschaft gerade wieder konservativer?
Ich halte das konservative Lebensmodell mit seiner Werthaltung für absolut mehrheitsfähig. Die Menschen wollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen und gestalten. Es gibt auch eine starke Solidargesinnung, denken wir nur an Freiwillige Feuerwehren oder Rettungsorganisationen. Alles, was uns Christlichsoziale im Kern ausmacht, wird mehrheitlich gelebt. Für mich ist konservativ daher ein sehr moderner Begriff. Werthaltungen müssen im politischen Leben auch erkennbar sein. Politik ist nicht nur Day-by-Day-Management, wo man halt Probleme löst, sondern man muss auch erklären können, warum man sie genau so löst. Am Ende des Tages ist es auch das, wonach der Wähler an der Urne entscheidet, warum er seine Stimme gibt oder nicht – weil er das Gefühlt hat, seine Werte repräsentiert zu sehen.
Vor einigen Jahren haben Jan Fleischhauer und Alexander Gauland (noch vor Gründung der AfD) darüber diskutiert, was konservativ bedeutet. Fleischhauer meinte, für ihn bedeute es zunächst einmal „nicht links sein“. Gauland hat konservativ eher nach Edmund Burke als Methode der Politik definiert, wonach der Konservative Neues annimmt, sobald er es als besser als das Alte erkannt hat. Das wäre ein Widerspruch zur Annahme, der Konservative zeichne sich durch Grundwerte aus.
Mein Zugang ist die Grundhaltung, sind die Werte. Eine Methode alleine wäre mir zu wenig. Wir wollen der Gesellschaft einen Rahmen geben, damit es den Leuten besser geht. Ich glaube, dass das mit unseren Grundwerten besser geht. Die müssen sich in der Praxis natürlich bewähren.
Es gibt unterschiedliche Zugänge zum Konservativismus. Der eine interpretiert ihn beinahe libertär, der andere eher etatistisch, vielleicht nahezu melancholisch. Einig ist man sich aber zumeist über den Leistungsbegriff, der in einem gewissen Spannungsverhältnis zum Sozialstaat steht. Muss der Konservative heute ein Zurückfahren des Sozialstaates fordern?
Nein, das glaube ich nicht. Der Zugang der meisten Menschen in unserem Land ist sicherlich, selst etwas zustandebringen zu wollen. Gleichzeitig braucht es ein Netz für all jene zu haben, die das nicht können. Die müssen sich zu 100 Prozent darauf verlassen können. In den Graubereichen ist das etwas anderes. Wir brauchen den Mut, auch klar zu sagen: Soziale Unterstützung ist für Notlagen da, wenn jemand Hilfe braucht – aber dann ist es auch wieder zu Ende. Darum haben wir auch die Mindestsicherung für Asylberechtige im Land neu aufgestellt, weil wir nicht vermitteln wollen, dass Leistung des Staates auf Dauer ein Lebenskonzept ist. Unser Konzept heißt, durch eigene Leistung leben können und helfen, solange einer das nicht kann.
Da kommt die Generationengerechtigkeit ins Spiel. Für die Jungen bedeutet das ein nicht eingelöstes Versprechen – es hat geheißen, wenn du fleißig bist, kannst du dir etwas aufbauen. Angesichts ächzender Pensionskassen und eines zu niedrigen realen Pensionsantrittsalters und der daraus resultierenden Abgabenlast ist das in weite Ferne gerückt.
Das wirklich perfide an dieser Diskussion ist, dass jedes Mal, wenn man versucht, das Thema anzugehen, denjenigen, die schon in Pension sind, so viel Angst eingejagt wird, dass die Debatte im Keim erstickt. Davon halte ich gar nicht. Alle, die heute in Pension sind, werden nicht betroffen sein. Das gesamte System muss wieder generationengerecht werden, damit auch die Jungen an die Zukunft glauben können. Im Landesdienst haben wir vor einigen Jahren auf ASVG-Pensionen umgestellt. Das ist nicht einfach, aber es gibt Verständnis dafür – fernab vom Populismus. Wenn ich nüchtern auf die Zahlen schaue, dann kann ich gar nicht übersehen, dass hier dringender Handlungsbedarf besteht und dass daran kein Weg vorbeiführt.
Zum Abschluss: Josef Pühringer war 1995 bis 2017 Landeshauptmann. Wie lange bleibt Thomas Stelzer?
Jetzt bin ich es gerade frisch geworden und habe das Ziel, bei der nächsten Wahl 2021 mit der ÖVP klar und stark die Nummer eins zu sein. Die Situation, in der uns die Landtagswahl 2015 hinterlassen hat, ist unbefriedigend. In der Politik kannst du nur Schritt für Schritt gehen – und das ist meine Messlatte.
Der Schritt in die Selbständigkeit gilt landläufig als großes Risiko und ist mit vielen Vorurteilen versehen. Einer, der es trotzdem getan hat, berichtet aus der Praxis.
Das Interview mit Mag. Alexander Putzendopler führte Richard Gansterer (TKW)
Du hast heuer deine eigene Kanzlei eröffnet. War Dir schon als Jusstudent klar, dass Dein Weg Richtung juristische Selbständigkeit gehen würde?
Im Gegenteil. Nach dem Abschluss meines Studiums wollte ich keinen juristischen Kernberuf ergreifen und war mehrere Jahre in verschiedenen Branchen tätig. Nach einem Unfall musste ich mir eine Übergangslösung suchen, da begann ich – eher unwillig – die Konzipientenlaufbahn. Aber bald wurde mir klar, dass ich nichts Anderes mehr machen will, ich meinen Wunschberuf gefunden hatte. Ich war danach in verschiedenen Ausbildungskanzleien tätig. Am meisten konnte ich fachlich wie menschlich von Michael Stögerer (Rd) mitnehmen, der Einzelanwalt in Wien ist. Dank ihm bekam ich ein konkretes Bild davon, wie der eigentliche Anwaltsberuf, zumal als „Einzelkämpfer“, aussieht.
Hat es Dich nicht abgeschreckt, dass auf Einzelunternehmer viel mehr organisatorischer Aufwand zukommt?
Man trägt als Selbständiger vor allem die gesamte unternehmerische Verantwortung – im Gegensatz zu Angestellten, die „nur“ inhaltliche Aufgaben übernehmen. Aber mir geht es um die Freiheit die man hat, daher ist es auch die beste berufliche Entscheidung, die ich je getroffen habe. Theoretisch müsste ich nicht jeden Tag um 8:30 in der Kanzlei erscheinen. Natürlich tue ich es, da die Arbeit getan sein will. Jedoch zu wissen, dass ich nicht müsste und mein Berufsleben so gestalten kann, wie es für mich passt – das ist mir mehr wert als die Sicherheit eines Angestelltenverhältnisses. Das ist, frei nach Max von Schenkendorf, die Freiheit, die ich meine.
Gerade in Wien hat man das Gefühl, dass der juristische Markt stark gesättigt ist. Hast Du mit dem Gedanken gespielt, Dich in einer anderen Stadt oder am Land niederzulassen?
Ja, in Wien gibt es die höchste Dichte an Rechtsanwälten. Man findet aber immer eine Möglichkeit der Spezialisierung. Man muss aber dahinter sein, egal wo man sich niederlässt. Andere Landeshauptstädte wie Graz oder Klagenfurt sind aber ein schwierigeres Pflaster als Wien, auch wenn dort weniger Anwälte tätig sind.
Während des Studiums geht man meistens sehr tief in die Materie, teils auch in sehr komplexe Fälle. Würdest Du sagen, Dein Studium hat Dich auf die Arbeitswelt gut vorbereitet?
Was einem keiner erzählt ist, dass das echte Leben ganz anders aussieht. Gerade in der Juristerei löst man auf der Uni oft extrem komplexe, dabei aber sehr akademische „Lehrbuchfälle“. Die wirkliche Herausforderung in der Praxis liegt hingegen auf der menschlichen Ebene. Oft sind starke Emotionen im Spiel und an manchen Prozessen hängen ganze Existenzen. Der Anwalt muss seinem Mandanten die richtigen Fragen stellen, um herauszufinden, was er bezweckt. So kann man für alle Beteiligten die kostengünstigste und nervenschonendste Lösung finden, die oft nicht vor Gericht zu suchen ist.
Sollte es Deiner Meinung nach im Studium einen verstärkten Fokus auf diesen Aspekt legen, oder kann man das nur in der Praxis lernen?
Ich habe mich oft darüber geärgert, dass die Uni sehr theoretisch ist. Mittlerweile habe ich meine Meinung geändert, denn genau dafür ist die praktische Ausbildungszeit da. Ein Studium ist nie Berufsaus-, sondern Vorbildung. Was im Studium aber wirklich zu kurz kommt, ist die praxisrelevante Recherchekompetenz. Natürlich kann man sich für Seminararbeiten auf die Bibliothek setzen und Materialien raussuchen, aber wie ich in kurzer Zeit Lösungen zu konkreten Fragen finde, kommt zu spärlich vor.
Als Unternehmer steht man immer wieder in der öffentlichen Kritik, wie gehst Du damit um?
In Österreich herrscht das Bild vor, dass Unternehmer durchtriebene Ausbeuter sind. Auch von Seiten des Gesetzgebers und der Verwaltung werden ihnen immer wieder – ich traue mich fast zu sagen ideologisch bewusst – Steine in den Weg gelegt. Dazu kommt noch, dass Unternehmer, wenn sie erfolgreich sind, mit Neid und falls sie scheitern, mit Spott bedacht werden. Das Risiko, das man auf sich nimmt, wird nicht honoriert – obwohl es der Markt, also der Unternehmer ist, der Arbeitsplätze schafft, und nicht der Staat. Dagegen sollte man sich wehren und gerade deswegen den Schritt in die Selbständigkeit wagen, allen Widrigkeiten zum Trotz. Man darf auch keine Angst vor dem Scheitern haben, denn zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.
Welche Steine meinst du damit?
Hier muss man zwischen Gewerbetreibenden und Freiberuflern unterscheiden. Wir Anwälte haben vergleichsweise wenige bürokratische Probleme, weil das die Rechtsanwaltskammer für uns erledigt. Ich hatte allerdings dennoch Probleme – etwa mit der Finanz, die nicht in der Lage war, eine Steuernummer zu vergeben, und damit war es noch nicht getan: Man weiß auch nicht, dass man mehr als nur eine Steuernummer braucht, sondern drei verschiedene. Das sagt einem auch keiner.
Die Klage über die überbordende Bürokratie ist ja keine Neuigkeit. Gibt es aktuelle Entwicklungen?
Ja. Es kommen leider immer wieder neue Richtlinien dazu, die jeweils zusätzlichen Aufwand für eine Kanzlei bedeuten. Diesen Zusatzaufwand kann man nicht immer in Rechnung stellen, muss ihn aber betreiben, weil die Nichteinhaltung natürlich unangenehme Konsequenzen hat. Gerade Österreich nutzt neue EU-Richtlinien gerne, um bei der Umsetzung in nationales Recht wiederum Aufwand zu generieren. Das hat nicht direkt mit der Gründung zu tun, aber man muss sich von Anfang an damit beschäftigen.
Das ist natürlich brutal. Wie ist die Regulierungssicht gerade für Kleinunternehmer und Gründer aus Deiner Sicht zu beurteilen?
Man muss bedenken, dass wir Anwälte als Freiberufler da noch gut wegkommen. Ein Gewerbetreibender hat wesentlich mehr zu beachten, weshalb ich unbedingt dazu rate, einen Juristen zu befassen, der sich auch auskennt. Gewerbeberechtigung, die Debatten mit der SVA und vieles mehr, es gibt genügend Stolpersteine – die kann man aber vermeiden, dafür gibt es ja Helfer. Man blickt neidisch nach Neuseeland, wo du den Gewerbebetrieb innerhalb von zwölf Stunden aufnimmt. Dort sind aber Unternehmertum und Arbeitsplätze schaffen auch positiv konnotiert, anders als bei uns.
Viele glauben, mit Gründung einer Kapitalgesellschaft kann man sich vor Problemen schützen.
Das stimmt nur zum Teil, außerdem muss man sich auch anschauen, welche Unternehmensform für die jeweilige Tätigkeit und den erwarteten Umsatz passt. Unabhängig von der Rechtsform entsteht immer die Frage, wie wird die Unternehmenstätigkeit genau ausschauen, wie komme ich an Kunden, wie sind die Abläufe, wie ist der Businessplan, welche Fehler kann ich von vornherein vermeiden. All diese unternehmerischen Strukturfragen gilt es zu lösen, auch dafür ist es sicher klug, einen unbeteiligten Dritten zu Rate zu ziehen. Wir Anwälte haben damit auch viel Erfahrung, weil wir genau das regelmäßig tun.
Zurück zur gesellschaftlichen Betrachtung der Unternehmer: Wie kann man diesem Paradigma entgegensteuern, wo siehst Du den Knackpunkt?
In meinen Augen ist diese Herangehensweise primär eine Konsequenz unseres hoch ideologisierten Bildungssystems. Unsere Schulbücher sind gespickt mit anti-liberaler Propaganda und „Kapitalismuskritik“ von selbsternannten Experten der linken Szene.
Du spielst damit auf den Globalisierungskritiker Christian Felber an, der als großer Wirtschaftstheoretiker in Schulbüchern der AHS-Oberstufe angeführt wird?
Ja. Bereits Jugendlichen werden kommunistische Grundkonzepte im Rahmen eines „neutralen“ Unterrichtes eingebläut und das nicht nur aufgrund der Schulbücher, sondern weil auch die meisten Lehrer sich zur linken Intelligenzija zählen und es als unerlässlich erachten, ihre Vorstellungen einer sozialistischen Utopie weiterzugeben. So findet eine Institutionalisierung der Neidkultur schon im Jugendalter statt. Sachliche Diskurse und eine differenzierte Betrachtung bleiben auf der Strecke, es wird dadurch das Pflänzlein des Unternehmergeistes im Keim zum Verdorren gebracht.
Woran denkst du dabei speziell?
Ein gutes Beispiel ist Christian Lindner, der derzeitige Chef der FDP in Deutschland. Er hat einmal ein Unternehmen gegründet, das gescheitert ist. Das wird ihm bis heute hämisch von Rot und Grün vorgehalten. Diese Mentalität schreckt viele ab, entweder einen zweiten Versuch zu wagen oder überhaupt diesen Weg zu gehen.
Was kannst Du unseren Lesern abschließend auf dem Weg in die Selbständigkeit mitgeben?
Ärgert Euch darüber, Nettosteuerzahler zu sein, aber schämt Euch nicht dafür!
Christoph Neumayer (BVW) ist für seine scharfen Analysen der heimischen Politik und Wirtschaft bekannt. Im Couleur-Interview spricht er über Ausbildung, Standortpolitik und die Frage, wie denn das mit dem Leadership ist.
Das Gespräch führte Philipp Jauernik (FRW)
Wir leben in einer stark sich verändernden Welt. Dein Tipp – was sind Qualifikationen, die es heute und künftig brauchen wird?
Wir erleben nicht zuletzt durch die Digitalisierung disruptive Veränderungen. Wenn man da aus Sicht der Industrie einen Tipp geben kann, dann lautet der: Alles, was in Richtung Naturwissenschaften und Technik geht, wird in der Nachfrage weiter steigen – auf allen Qualifikationsstufen, egal ob schulisch oder akademisch. Sehr viele Industrieunternehmen suchen besonders stark nach Softwaretechnikern. Alles in diesem Bereich, idealerweise mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen verbunden, wird stark nachgefragt. In Zukunft werden noch mehr Menschen in ihrem Leben verschiedene Berufsbilder verbinden. Die Herausforderung ist, den Menschen dabei zu helfen, mit diesen Veränderungen umzugehen – sich auf die Veränderungen einlassen, resilient werden.
Bildung und Ausbildung stehen dem Anschein nach immer etwas im Konflikt. Der IV sagt man nach, eher in Richtung Ausbildung zu denken. Ist reine Ausbildung nicht beinahe eine Sackgasse – immerhin überholen sich Ausbildungsinhalte, Berufsbilder verändern sich stark.
Ich bin selbst Geisteswissenschaftler und sehe diese Spannung auch. Die IV setzt allerdings auf eine möglichst breite, humanistische Allgemeinbildung in Kombination mit einer möglichst guten Ausbildung, die dich befähigt, am Arbeitsmarkt zu reüssieren und auf neue Herausforderungen zu reagieren. Das lebenslange Lernen ist in vielen Unternehmen ein großes Anliegen, sie investieren viel Geld in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Dazu braucht es natürlich auch die Bereitschaft. Eines ist klar: Wir brauchen Menschen mit einem breiten Bildungsfundament, andernfalls können wir auch politisch die Zukunft nicht meistern.
Wie beurteilst du den heimischen Arbeitsmarkt zur Zeit?
Wir haben die gegensätzlich wirkende Situation einer Rekordarbeitslosigkeit, aber auch sehr viele freiwerdende Stellen. Das betrifft vor allem den technischen Bereich. Sieben von zehn befragten Unternehmen sagen, sie suchen Mitarbeiter für spezifische Bereiche – hier gibt es ein fehlendes Zusammenkommen zwischen Arbeitgebern und Arbeitssuchenden.
Die Generation um 50 wird oft als „Problemgeneration“ beschrieben – zu jung für die Pension, aber scheinbar zu alt für teure Weiterbildung. Gibt es aus Deiner Sicht Anzeichen, woran ein Arbeitnehmer erkennen kann, dass für ihn der Zeitpunkt für eine Weiterbildung gekommen ist?
Ich glaube, das hört nie auf. Spätestens ab 40 muss man sich aber besonders stark fragen, wie die nächsten 20, 30 Jahre aussehen sollen – idealiter in Abstimmung mit dem Arbeitgeber eine Bestandsaufnahme, was bringe ich mit, was braucht es künftig. Ich bemerke hier auch ein Umdenken der Unternehmen, gerade erfahrene Mitarbeiter länger im Unternehmen zu halten. Noch in den 1970ern und 1980ern gab es viele Frühpensionierungen, da haben wir – je nach Branche – ein bisschen einen Gegentrend. Gerade in der Krise 2008 hat sich gezeigt, dass den Unternehmen gute Mitarbeiter besonders wichtig sind.
In der Generation um 30 fällt auf, dass viele hochqualifizierte Leute erstaunlich lang Job suchen. Natürlich sind viele davon wählerisch – aber oft scheint das „Matching“ zwischen Suchenden und Wirtschaft in der Personalabteilung zu scheitern. Dort wird oft nach Standardkriterien gesucht, wo „buntere“ Lebensläufe Probleme haben können.
Recruiting ist ein spannendes Thema. Ich glaube, dass hier generell sehr professionell gearbeitet wird. Der Gap ist sicher da, woran er liegt, ist nicht einfach zu generalisieren. Ich rate den Jungen immer, schon während der Ausbildungszeit Arbeitserfahrung zu sammeln, das macht später viele Dinge einfacher. Es ist auch so, dass das Ausbildungsniveau stark gestiegen ist. Was früher das Studium war, sind heute zwei Studien mit mehreren Fremdsprachen. Spannend für viele Unternehmen ist aber auch, was ist über die Ausbildung und über Praktika hinaus da – soziales Engagement, Vereinsengagement, wird etwas Gesellschaftliches getan. Wir als IV schauen genau darauf, weil das erst eine Persönlichkeit abrundet. Eine Kritik kann man schon anbringen: Während etwa angelsächsische Unternehmen eher auf die Performance im Studium schauen, gehen wir in Österreich formalistischer vor und schauen eher auf das Fach als auf die Person.
Ein weiterer Widerspruch scheint zu sein, dass die Industrie zu wenig ausbildet, gleichzeitig aber ein Facharbeitermangel herrscht.
Die Industrie ist einer der größten Ausbildner von Lehrlingen, das ist über Jahre stabil. Unsere Herausforderung ist heute, dass das Anforderungsprofil 2017 ein höheres ist als 1987. Die Ansprüche sind massiv gestiegen – und die jungen Menschen, die aus dem Schulsystem herauskommen, entsprechen den Ansprüchen immer weniger. Die Maschinen sind komplexer und müssen verstanden werden. Junge Menschen verlassen nach Ende der Bildungspflicht die Schule und beherrschen die Grundrechnungsarten unzureichend – vom zwischenmenschlichen wie Manieren reden wir da gar nicht. Das ist der Kernpunkt, da ist ein massives Problem aufgetreten.
Also kein Motivationsproblem seitens der Industrie?
Nein, das sehe ich wirklich nicht. Lass mich noch einmal 2008 als Beispiel nehmen: Der Zusammenbruch der Wirtschaft hätte noch vor Jahrzehnten zu Massenkündigungen geführt. Die gab es diesmal nicht. Die Unternehmen haben alles versucht, um ihre Mitarbeiter zu halten – gerade weil es heute so schwierig ist, sie zu finden. Der Stellenwert der Mitarbeiter in Industrie und Export ist massiv gestiegen.
Lösungen wie die Kurzarbeit haben da aber auch mitgeholfen.
Natürlich, aber das hatte ja genau das Ziel, diese Mitarbeiter zu halten. Das hat auch gut funktioniert.
Das Problem der mangelnden Eintrittsqualifikation ist ja sehr diffizil. Ansetzen könnte man bei einer Verbesserung des Schulsystems, wo Generationen von Bildungsministern ihre liebe Not hatten. Aber auch die guten Ansätze haben ein Problem, sie funktionieren nicht schnell. Was schnell funktioniert, auch wenn es politisch derzeit inopportun ist, ist Zuwanderung.
Hier wäre natürlich ein Paradigmenwechsel nötig. Zuwanderung ist dann sinnvoll, wenn die Zuwanderer die Chance bekommen, sich zu integrieren. Dazu gehört auch der Arbeitsmarkt. Wir waren immer für qualifizierte Zuwanderung, wie es andere Länder erfolgreich praktizieren. Die Einführung der rot-weiß-rot-Card ist ein Schritt in diese Richtung gewesen. Im neuen Arbeitsprogramm der Bundesregierung sind einige gute Anpassungen enthalten, damit das auch gut funktioniert – für Drittstaatenangehörige. Wir würden uns aber ein Einwanderungsgesetz wünschen, worin definiert ist, wen wir anwerben wollen, welche Kriterien derjenige erfüllen muss – dann funktioniert auch Integration. Das muss man aber ganz klar von der unkontrollierten Flüchtlingsbewegung der vergangenen zwei Jahre trennen. Viele dieser Menschen verfügen über unzureichende Ausbildung, woraus Anpassungsschwierigkeiten entstehen. Viele – um es klar zu sagen – sind Analphabeten. Das ist eine Herausforderung für die nächsten 20, 30 Jahre.
Es gibt erste Repatriierungsprogramme für Wirtschaftsflüchtlinge, zum Teil über europäische Unternehmen, die einen Flüchtling hier ausbilden und mit ihm dann in seinem Herkunftsland einen Standort eröffnen. Kritiker meinen, das würde die Flucht erst recht attraktivieren.
Letztlich müssen wir auf europäischer Ebene gemeinsam Entscheidungen finden, um die Situation zu lösen, alleine geht es nicht mehr. Die Diskussion um einen Marschallplan für Nordafrika ist nicht von der Hand zu weisen, da muss man klotzen, nicht kleckern. Da reden wir von Summen, die weit über dem liegen, was derzeit im Spiel ist. Diese Programme sind eine gute Möglichkeit, die weniger herausfordernd ist als das, was die europäischen Staaten jetzt versuchen.
Grenzen dicht alleine ist also nicht die Lösung?
In letzter Konsequenz brauchen wir eine gesamteuropäische Lösung, so wie das alle sehen, die vernünftig sind. Man muss Zuwanderung gestalten, fair gestalten. Aus österreichischer Sicht ist klar, dass wir an einem Punkt sind, wo die Integration enorm herausfordernd ist. Innerhalb Europas Grenzbäume wiederaufzubauen bringt uns dabei aber weder sicherheitspolitisch noch gesellschaftlich weiter.
Gehen wir zur engeren Standortpolitik, den Standortfaktoren. Entbürokratisierung und gute Infrastruktur sind Ansiedelungsargumente für ausländische Betriebe, aber auch die Lebensqualität, weil man damit qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen kann. Gerade bei Infrastrukturprojekten kann das ein Reibebaum sein.
Standortpolitik ist manchmal etwas sehr komplex, das stimmt. Es gibt weiche und harte Standortfaktoren. Zu den weichen zählt eben die Lebensqualität, die harten haben oft mit Kosten zu tun. Österreich steht, wie viele Staaten, in einem Wettbewerb. Wir sind ein Hochlohn- und Hochsteuerland, haben ein ausgeprägtes Sozialsystem, aber auch eine groß ausgeprägte Bürokratie. Die Qualität der Verwaltung ist oft sehr gut, und auch eine gute Verwaltung und Rechtssicherheit sind Standortfaktoren. Aber die Republik braucht eine Aufgabenreform, schlankere Strukturen. Dazu kommt noch das Bildungssystem. Diese Faktoren müssen in Balance gehalten werden. Die Lohnnebenkosten sind derzeit besonders belastend, vier Prozentpunkte höher als Deutschland. Österreich hat hohes Effizienzpotential. Wir stehen zum Sozial- und Wohlfahrtsstaat europäischer Prägung.
Stichwort Rechtssicherheit: Böse Zungen sagen, die spanische Wirtschaft hätte sich ausgerechnet zu der Zeit erholt, als keine Regierung amtierte und dadurch Unternehmer wussten, dass die Gesetze jetzt einmal auch Bestand haben.
Das Thema hier heißt Vertrauen – eine enorm hohe Währung. Permanente Veränderung der Gesetzgebung, oder gar eine rückwirkende Veränderung, sind dabei höchst gefährlich. Das ist bei uns in der Steuerpolitik in jüngerer Vergangenheit gleich mehrmals passiert. Der Rechtsrahmen muss vorausschauend erkennbar und klar sein. Alles andere sind Knüppel zwischen die Beine der Wirtschaft.
Es gilt als unbestritten, dass die Deindustrialisierung Mitteleuropas mit den hohen Lohnnebenkosten zusammenhängt – gleichzeitig ist klar, dass das niedrige Lohnniveau Chinas oder Indiens sowieso nicht erreichbar ist, was ja auch niemand will.
Österreich ist Teil des industriellen Herzens Europas. Wir haben eine starke Produktionsregion mit Norditalien, Österreich, Tschechien, der Slowakei oder Bayern. Österreich ist nach wie vor ein Industrieland. Frühere Theorien der 1980er und 1990er gingen davon aus, dass gerade Basisindustrie hier gar nicht mehr möglich sein werde – nach wie vor ist aber die Metallindustrie prägend. Die Digitalisierung ist eine große Chance. Wir sind kein Billiglohnland, wollen auch keines sein und keines werden. Hier folgt ein Aber: Unser größter Exportpartner ist Deutschland. Da war Österreich bei den Arbeitskosten lange günstiger, das ist jetzt anders. Gerade für Zulieferunternehmen ist das ein richtiges Problem. Wir wollen keine Löhne drücken, aber wir brauchen eine Balance. Es muss attraktiv bleiben, hier noch zu produzieren.
Der Bürger hat oft den Eindruck, da ginge nichts weiter. Ist das so?
Zum Glück nicht ganz. Die Erhöhung der Forschungsquote von 12 auf 14 Prozent ist ein enorm wichtiges Signal in eine richtige Richtung. Wir sind auch gerade in einer Lohnnebenkostensenkung, da habe ich mitverhandelt. Da gibt es heuer und nächstes Jahr einen kleinen Schritt. Trotzdem: Die Arbeitskosten müssen hinunter.
Ein Teil des Frustes in der Bevölkerung könnte damit zu tun haben, dass man das Gefühl hat, es bräuchte einen Befreiungsschlag, einen großen Wurf. Das sind diese beiden Dinge nun wirklich nicht.
Unsere Situation ist nicht einfach: Es gibt zwar ein Wachstum, aber ein so großes Wachstum, wie es uns früher oft aus solchen Situationen herausgeholt hat, wird es auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Wir sind also gezwungen, das System zu reformieren. Der große Wurf ist aber in derjenigen Konstellation, die wir politisch und bei den Sozialpartnern erleben, nicht möglich. So ehrlich müssen wir sein.
War das jemals anders?
In den 2000ern hatten wir eine Phase großer Reformen, wo ein Ruck durch’s Land ging, und auch jetzt haben wir eine Phase, wo sich etwas verbessert. Wir sehen eine Bundesregierung, die bereit ist, ein bisschen mehr zu tun als es zuvor möglich war, das muss man anerkennen. Aber das, was rein sachlich alles sein müsste, ist in dieser Gemengelage realpolitisch nicht möglich.
Die ÖVP ist mit ÖAAB und Wirtschaftsbund breit aufgestellt, die FPÖ schlingert bisweilen im wirtschaftspolitischen Kurs – Stichwort Wertschöpfungsabgabe, wo man in Wien dagegen ist und in Brüssel dafürstimmt.
Jede Partei, die mitregieren möchte, weiß in Wirklichkeit, dass sie auch Kompetenz in Wirtschaftsfragen braucht. Eine funktionierende Wirtschaft und Industrie ist die Basis jeder Wohlstandsgesellschaft, weil die Dinge, die man verteilen will, ja erarbeitet werden müssen. Hier kluge, stringente Konzepte zu haben, ist wichtig, auch damit jeder abschätzen kann, was einen eigentlich erwartet, wenn es zu einer Regierungsbeteiligung kommt. Die FPÖ hat kommuniziert, dass sie an einem Wirtschaftsprogramm arbeitet. Entscheidend wird letztlich sein, was da drin steht. Das Zweite ist die Frage, ob die Parteien jenes Programm, auf das sie sich einigen, auch vertreten. Da geht es auch um die Frage, ob man darin Vertrauen haben kann, weil das entscheidend ist für die Stabilität, die wir brauchen. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten haben wir fast zu viel Stabilität gesehen, die oft in Stillstand auswuchs. Das reicht in der Welt, in der wir leben, nicht.
Wir haben die Infrastruktur schon angesprochen. Mit einigen Tunnelprojekten wurden da viel angestoßen, der Output steht aber wirtschaftlich in Frage. Wie sinnvoll sind solche Projekte?
Das muss man immer abwägen. Manche Projekte haben einen sehr langfristigen volkswirtschaftlichen Nutzen. Manche Studien sehen das positiver, andere kritischer. Klar ist aber, dass eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur das Rückgrat einer funktionierenden Wirtschaft ist. Es wird immer mehr Just-in-time produziert, Waren müssen zeitgerecht und schnell geliefert werden können. Infrastrukturknoten sind immer auch Wohlstandsknoten. Die Frage liegt in der Priorisierung. Ich glaube, das muss immer wieder hinterfragt und abgeschätzt werden. Die begonnenen Tunnelprojekte jetzt noch zu stoppen wäre natürlich völlig sinnlos. Dazu kommen die europäischen Verkehrskorridore – wie sehr sich Einzelprojekte rechnen, muss man auch im größeren Kontext sehen. Die Projekte werden volkswirtschaftlichen Nutzen bringen, davon bin ich überzeugt. Ob der so groß ist, dass die Baukosten in direkte Relation gestellt werden kann, darüber kann man sicher streiten. Aber das diese Dinge notwendig und sinnvoll sind, ist kaum zu leugnen.
Abwägen ist ein gutes Stichwort – das musste das Bundesverwaltungsgericht vor nicht allzulanger Zeit in Schwechat tun.
Über diese Entscheidung sind wir wirklich hochgradig unglücklich, sowohl juristisch als auch von der Begründung her. Es geht um die Balance, wie will ich dieses Land weiterentwickeln. Wenn ein Gericht den Bodenverbrauch oder – und da ist es wirklich eine Themenverfehlung – den Klimaschutz über die anderen Punkte wie zusätzliche Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Bedeutung stellt, dann ist das hinterfragenswürdig. Das auch deshalb, weil ja der Flugverkehr bereits einem rigiden Klimaschutzregime unterliegt. Wo haben wir da eine vernünftige Balance? Das Urteil ist deshalb gefährlich, weil es ein Präjudiz für weitere Projekte werden könnte. Man kann gleichermaßen bei jedem Produktionsstandortvergrößerung oder jeder Straße argumentieren. Ich finde es bedenklich, wenn Gerichte Politik machen und sich arrogieren, hier über der politischen Ebene stehen.
Reden wir über die Freihandelsabkommen. Die IV hat sich für CETA stark gemacht – ein Abkommen, dass unter Einbeziehung und mit Auftrag der Bundesregierung jahrelang verhandelt wurde, aber nachher sich kaum dafür eingesetzt hat.
Wir haben zu wenige mutige Politiker. Kaum noch jemand ist bereit, sich in den Diskurs zu begeben, Positionen und Werte nachhaltig zu vertreten, wie auch immer sie aussehen mögen. Der Diskurs ist unglaublich oberflächlich geworden. Wir haben eine Politikergeneration gesehen, die sich primär nach dem Boulevard, nach Stimmungen ausgerichtet hat. Die Menschen haben aber Sehnsucht nach Leadership. Sie sind auch bereit, anzuerkennen, wenn sie anderer Meinung sind, das ein Politiker für etwas steht. Wenn wir das nicht wieder sehen, wird es ganz schwierig in Österreich und ganz Europa. Ich bin etwas optimistischer, weil jüngere Politiker nachkommen, die Positionen beziehen, die sie für sachlich richtig halten, auch wenn es noch nicht mehrheitsfähig ist. Die brauchen wir, die müssen mehr werden.
Mir hat ein Unternehmer kürzlich gesagt, würde ich ein Unternehmen führen wie viele Politiker agieren, wäre ich schnell pleite. Wären Unternehmer die besseren Politiker?
Politik und Unternehmertum sind ganz unterschiedlich. Aber viele unternehmerische Tugenden hätten, wenn sie klug umgesetzt sind, in der Politik sicher Platz – etwa eben Leadership , sich voranstellen, Verantwortung übernehmen, die Dinge auch kommunizieren.
Eine Frage an Dich als MKVer: Was hast Du bei der Verbindung gelernt, was würdest Du Dir vom Verband wünschen?
Als junger Mensch war für mich besonders wertvoll, Verantwortung zu übernehmen, Dinge zu organisieren und dafür auch einzustehen und sich letztlich auch verantworten zu müssen. Ich war ein eher schüchterner Typ. Gezwungen zu sein, seine Entscheidungen zu argumentieren und zu verantworten war ein sehr wertvoller Lerneffekt. Dem Verband wünsche ich, dass er gesellschaftspolitisch aktiv bleibt und wahrgenommen wird, dass er mutig bleibt und seine Werte klar vertritt.
Drei Wünsche an die Politik?
Über den Tellerrand schauen, Entscheidungen treffen und kommunizieren, Leadership zeigen.
Interviews: Die Personen
Mag. Thomas Stelzer
Thomas Stelzer (*1967) ist seit dem 6. April 2017 Landeshauptmann von Oberösterreich. Die politische Karriere des Juristen begann 1986 bei der Jungen ÖVP, deren Landesobmann er 1992 wurde. 1991 wurde er Gemeinderat in Linz, 1997 Landtagsabgeordneter. 2009 bis 2015 war er Klubobmann, danach Landesrat für Bildung, Jugend und Forschung. Thomas Stelzer ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Mag. Alexander Putzendopler
Alexander Putzendopler (*1986) studierte in Graz Rechtswissenschaften. Vor der Advokatur in unterschiedlichen Branchen tätig, darunter Wissenschaft, Handel und Interessensvertretung. Seit März 2017 ist er in Wien als selbständiger Rechtsanwalt tätig, Spezialisierung auf die Gebiete Allgemeines Zivilrecht, Wohnrecht und Waffenrecht.
Mag. Christoph Neumayer
Christoph Neumayer (*1966) studierte Geschichte und Kommunikationswissenschaften und absolvierte einen Hochschullehrgang Post Graduate Management. Seine Berufslaufbahn startete er im Medienbereich, seit 2011 ist er Generalsekretär der IV. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter.